Die
Eidgenossen
Am Rande der grossen Ereignisse, im Schatten der aufstrebenden Fürstenhäuser, veränderte auch der Raum zwischen Jura und Alpen, zwischen Genfersee und Bodensee sein Gesicht. In Vorahnung einer unsicheren Zukunft innerhalb des Reiches versuchten die Länder um den Vierwaldstättersee, Uri Schwyz und Unterwalden, ihr eigenes angestammtes Recht zu erhalten. So gelobten sie sich im Bundesbrief vom August 1291 als Eidgenossen gegenseitige Hilfe bei Gewalttaten, den Frieden im Lande und die Aufrechterhaltung der bestehenden Verhältnisse.
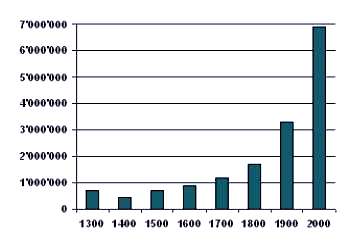
Die
Bevölkerungsentwicklung auf dem Gebiet der heutigen Schweiz
Innerhalb
weniger Jahrzehnte brach um die Mitte des 14. Jahrhunderts eine ganze Reihe von
Katastrophen über Europa herein. Missernten und Hungersnöte häuften
sich als Folge einer kleinen aber entscheidenden Klimaverschiebung. Das Wachstum
der Bevölkerung und des Siedlungsraumes geriet ins Stocken. Als 1347/48 die
Pest ganz Europa heimsuchte, traf sie auf eine bereits von vielen Hungerjahren
geschwächte Einwohnerschaft. Mindestens ein Drittel aller Menschen starb.
Während fast vierhundert Jahren brach die Pest in mehr oder weniger kurzen
Abständen aus und forderte ihren Tribut. Nur langsam erholte sich Europa
von dieser Katastrophe. Als die Krise im 15. Jahrhundert überwunden war,
herrschten ganz neue Verhältnisse.
Das grosse Sterben hatte das labile Gleichgewicht zwischen Stadt und Land, zwischen Fürsten und Rittern, zwischen Bergregionen und Flachland vollends hinweggefegt. Die Zeiten waren vorbei, in denen die Menschen fast alles Lebensnotwendige in der näheren Umgebung produzierten. Nur in wenigen Regionen des inneren Alpengebietes überlebten die althergebrachten Wirtschaftsformen. Vor allem entlang der grossen Verkehrsachsen entstanden neue Formen einer spezialisierten Land- und Viehwirtschaft. Die Bauern der Bergregionen konzentrierten sich immer mehr auf die Viehzucht, während die Flachlandbauern den Ackerbau intensivierten. So entwickelte sich ein reger Warenverkehr zwischen Bergregion und Flachland beidseits der Alpen, wobei die Städte des Mittellandes eine Schlüsselrolle einnahmen.
In dieser Situation verbündeten sich die Städte mit den ländlichen Orten, um gemeinsam Ruhe und Ordnung zu sichern. Der Ausbau des Bündnissystems, der Erwerb gemeinsamer Untertanengebiete und der Ansatz zu einer koordinierten Politik nach aussen änderten nichts daran, dass an ein gemeinsames Handeln nicht zu denken war. Die Bevölkerung der Landschaft pochte auf ihre alten Rechte und wehrte sich gegen den städtischen Ausbau der territorialen Herrschaft. Nach schweren und blutigen Konflikten gelang es den Städten, eine Form moderner Verwaltung durchzusetzen.
| Schlachtgebet der Eidgenossen (aus dem Dreissigjährigen Krieg) | |
Lasst
üs abermal bätte. | Für
üsi Chessel und Pfanne, Für üsi Gäns und Aente, Au isunderheit für üsi liebi Schwiz, Wenn der bluetig Chrieg wett cho, Wett alles nä, so wette mier üs trüli wehre, Und ihn nienä dure lah, Au der Find gar z'tod schlah. |
Die
Zeit vom 15. zum 17. Jahrhundert war gezeichnet von immer wieder aufflammenden
Bauern-kriegen und Aufständen der Untertanen, die sich um ihre erworbenen
Rechte betrogen fühlten. Die Reformation bestätigte die Spaltung, die
in der Eidgenossenschaft herrschte. Nach den Schwaben-kriegen von 1499 folgte
die faktische, aber erst mit dem Westfälischen Frieden von 1648, die gänzliche
Loslösung vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation.
Immer mehr
konzentrierten sich Reichtum und Macht bis ins 18. Jahrhundert in den grossen
Städten. Der wirtschaftliche Erfolg der exportorientierten Bergwirtschaft,
die Intensivierung der Landwirtschaft im Mittelland und die frühen Formen
der Industrie hingen mehr denn je von den Investitionen des städtischen Kapitals
ab. Nach und nach gerieten die überlieferten Herrschaftsstrukturen unter
Druck. 1798 brach die alte Eidgenossenschaft zusammen. Aus einem Agrarland wurde
ein städtisch geprägter Industriestaat, aus einem Geflecht von Aristokratien
eine moderne Demokratie.